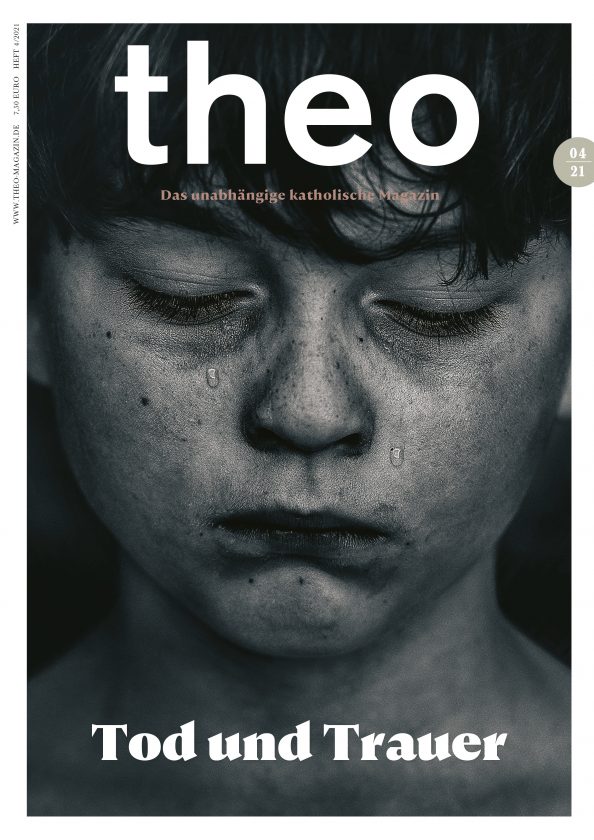Warum machen wir das eigentlich hier?“ Ich freute mich auf das Tete-a-Tete mit meiner Frau. 30 Minuten Fleischesglück zwischen Videokonferenzen, Schule und Mülltütenentleerung. „Was?“, fragte ich. „Die Bettnummer!“ Meine Frau, die Stimmungskillerin. Das kann sie wirklich gut. Dann lachte sie: „Lass dich nicht so hängen. Sag doch einfach: Weil es gut ist!“
Sex bei Lichte betrachtet ist aberwitzig, lächerlich, verstörend, anstrengend, unnötig, ineffizient. Ganz oft: keine Lösung. Der Körper spricht, wenn alles gesagt ist. Letzter Ausweg. Glaubt man der Philosophin Bettina Stangneth, leben wir im Zeitalter der Restlust. Eigentlich „ganz natürlich“, und doch in einer emotional-intellektuellen Verkrampfung, unendlich zerredet und zugleich umhüllt mit zahlreichen Tabus. Sex ist und war unendlich kompliziert.
Erotik sei ein JA zum Leben, findet der Kreativdirektor des französischen Glamour-Magazins Thomas Lental. Sex als Pornografie dagegen durchleuchtet, bar jeder Zärtlichkeit, offenbart eher ein Versprechen auf die doch eigentliche Übermacht des Todes, die die Kopulierenden anzutreiben scheint: Bloßes Fortpflanzungsgewürge mit dem eigenen biologischen Ende im Nacken.
Auch der oft zitierte französische Philosoph Bataille nennt die Erotik ein absolutes Ja zum Leben: Die Sehnsucht nach dem Anderen, der Überwindung des Abgrundes durch die Hoffnung auf Begegnung. Und das Opfer des eigenen Selbstverlustes. Der „kleine Tod“, wie der Orgasmus auch schön poetisch genannt wird, als lustvolles eigenes Ende. Bataille wäre nicht Bataille, würde er dem romantischen Vereinigungsgesäusel nicht mit seinem scharfen Schwert ernüchternder Relativierung begegnen: Erotik, die erweiterte Sexualität, sei zwar inneres Erleben, innere Erfahrung, angetrieben von einer Suche nach Erfüllung im Äußeren. Doch die Verschmelzung auf irdischer Ebene bleibe letztlich Illusion. Seit Platons Kugelmenschen seien wir physisch getrennt. Und nicht kittbar. Auch die schönste Erotik und der leidenschaftlichste Sex überwinden die Trennung nicht!
Für den Vater der modernen Psychoanalyse, Sigmund Freud, waren der Sexualtrieb und die Todesfurcht, benannt nach den griechischen Göttern des körperlichen Begehrens „Eros“ und des Todes „Thanatos“, allen Menschen innewohnende Triebkräfte, die unser Leben mehr oder weniger aus dem Unterbewusstsein heraus antrieben und steuerten. Von Ferne betrachtet Gegensätze. Aus der Nähe: Geschwister. Direkter ausgedrückt: Kopulationspartner. Sie halten uns Menschen im Lebenslicht. Fernab vom Dunkel eines ungewissen Todes.
Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki soll laut eigener Biografie im Warschauer Ghetto seiner zukünftigen Frau tröstend zur Hilfe geeilt sein, als sie weinend vor ihrem strangulierten Vater stand: Selbstmord. Seine Hand sei dabei von der Schulter zur Brust geglitten und dort minutenlang verweilt – ohne Widerstreben. Verstörende Vertrautheit mit Verschmelzungslust angesichts des grauenvollen Endes inmitten einer Todesszenerie.
Und auch die oft als „Meisterin der erotischen Literatur“ bezeichnete Anaïs Nin lässt in einer ihrer Kurzgeschichten eine Frau einer öffentlichen Hinrichtung beiwohnen und den gleichzeitigen Sexualakt mit einem nicht sichtbaren Fremden in einer amorphen, sensationslüsternen Zuschauermasse des Spektakels erleben. (A. Nin. Die verborgenen Früchte).
Als ich kurz nach meiner Studiumsdepression meiner Therapeutin gestand, dass der Agent der Königin, James Bond, mein leuchtender Archetypus sei, schrie sie mir förmlich entgegen: „So in Scheißkerl!“ Aus der Therapie, die mich eigentlich von den geistig-seelischen Wundern der französischen Existenzialisten und Nihilisten befreien sollte, ging ich damals noch verstörter hervor. Nicht nur der Mensch war anscheinend ein Sein, „das nicht das ist, was es ist, und das das ist, was es nicht ist.“ (Sartre). Sondern vor allem der Mann schien ein „Überhaupt-Nichts“ zu sein. Weil er die Frau unterdrücke. Und damit – ganz existenziell – ein Schwein ist. Heute ahne ich: Dieses Geschlechterding war der Kampf meiner Therapeutin. Mich hatte an Bond damals nicht nur fasziniert, dass vor ihm die Frauen dahinschmolzen. Er schien auch auf ewig den Tod zu besiegen. Zumindest das Sterben zu umgehen. Denn in die Luft flogen immer die Anderen. Und über die Jahrzehnte blieb Bond Bond. Während wir gefühlt jeden Tag ein bisschen sterben. Wenn es gut läuft. Uns also verändern: Körperlich. Geistig. Seelisch. Und irgendwann selbst draufgehen im Spiel des Fressens und Gefressenwerdens.
Womöglich ist das Christentum deswegen kein Verkaufsschlager, weil es das lustvolle Leben und Lieben ausblendet, stattdessen auf das ewige Leben verweist. Aus dem Todesüberwinder-Gott Jesus wurde das überhöhte Liebesopfer des Herrn: Genährt und geweckt durch das Abendmahl. Opferverspeisung. Für Bataille die höchste Liebesform – die heilige Erotik. Im Bewusstsein dieser Einheit sei die ganze Erotik die Bejahung des Lebens, die im Tod gefunden wird. Der wirklichen wahren, ewig dauernden Einheit, deren Unterbrechung das Leben sei. Und der Orgasmus als Moment des Vergessens, die Erinnerung an das große Ganze. Großes Kino. Voller Ernsthaftigkeit und Pathos.
Im Studium habe ich diese Wortspielereien geliebt. Und bin daran verzweifelt. Haben sie geholfen, dass mein Sex besser wurde? Nein! Helfen sie Menschen, die einen geistlichen Weg für sich gewählt haben, im Frieden mit ihren eigenen „Triebkräften“ zu leben? Nur begrenzt.
„Warum machen wir das eigentlich hier?“, fragte mich meine Frau vor unserem letzten Akt.
„Weil es gut ist!“, rufe ich heute aus innerer Überzeugung entgegen. Todesfurcht hin. Erotik her. /